Der Wilde Osten: Die Rigaer Straße in den 90ern
Der Wilde Osten war eine glückliche Zeit, die – wie vermutlich alle anderen Zeiten auch – einzigartig in der Geschichte der Zivilisationen bleibt. Der Blick geht zurück in die 90er Jahre nach Ost-Berlin. In der Rigaer Straße in Friedrichshain gab es dereinst ein besonderes Milieu, das bedrohten Spezies einen Lebensraum bot. Oder: Die Geschichte, wie ich in die Rigaer Straße zog.
Wie kam die junge Hoffnung … Wie ich in die Rigaer Straße kam? Nun, ich bin da nicht einfach hingezogen, es war quasi Schicksal. Ich wollte eigentlich eine Wohnung in der Proskauer Straße beziehen. Die Geschichte ist auch … sagen wir interessant: Per Zeitungsannonce hatte ich eine Wohnung gefunden. Gut gelegen und vor allem das absolut günstigste Angebot, das fast zu günstig war, um wahr zu sein. Und darüber hinaus auch noch zu haben? Nach einem kurzen Telefonat traf ich mich mit diesem Mann. Sein Aufenthalt in der Wohnung, das stellte ich später auch noch geruchlich fest, war andauernd und sein Lieblingshobby war rauchen. Aber sein Mietvertrag war aus dem Osten. Das erklärte die unschlagbar geringe Miete. Die Menschen zogen aus solchen Wohnungen nur aus, wenn sie mit den Füßen voraus heraus getragen wurden.

Für die jüngeren Lesenden: In den 90er Jahren waren Friedrichshain, Prenzlauer Berg (nur kurz) und Lichtenberg so unglaublich günstig, dass die kreative Szene und die allermeisten Studis hier her zogen. Die damals schon Betuchteren wohnten noch im Westen, wozu auch Kreuzberg zählt. Ein Mal nur die Seite der Spree gewechselt und die Preise purzelten. Das betraf nicht nur die Miete. Aber die coolen sanierten Altbauten in Kreuzberg oder Schöneberg, da wohnte der Geldadel. Wobei es auch auf den Teil des Bezirks ankam.
Der Vermieter der Wohnung war ein gewisser Peter. Den Nachnamen habe ich vergessen. Er trug eine vergilbte Jeansjacke über einem vormals weißen Hemd mit bunten Tupfern. Zeige- und Mittelfinger waren so vergilbt wie sein ganzer Teint. Er hatte einen Kamm in der Gesäßtasche und glaubte sich als Held in einer beschissenen Welt. Peter erklärte mir freimütig, er würde nach Brasilien übersiedeln und ein Leben unter Palmen starten, mit einem Kilo mitfinanziert von einem noch unbewilligten Bafög-Antrag und unterfinanzierten Studenten. Denn er erklärte mir, ich müsste für das ganze Zeugs in seiner Wohnung einen Abstand von 1.000 DM leisten. Angesichts der Miethöhe, so meine Kalkulation, hätte ich das innerhalb von einem Jahr wieder reingeholt. Die aufmerksam Lesenden haben bereits einen Verdacht und selbstverständlich war ich blöd genug, den Untermietvertrag zu unterschreiben.
Glücklich eine so günstige Wohnung gefunden zu haben, machte ich mich auf zum Frankfurter Tor, wo damals das Einwohnermeldeamt war. Die Nummer gezogen, eine freundliche Dame vom Amt begrüßte mich und meinte nach kurzem Prozedere, dass sie den Untermietvertrag nicht anerkennen würde. Die Lösung wäre ein Schriebs der Hausverwaltung. Und noch immer schwiegen meine Alarmglocken, nicht mal das Flackern eines Lichts oder das Surren einer Grille verdunkelten mein Vertrauen.
Die gute Frau von der WBS wusste nicht, soll sie weinen oder lachen. Sie entschied sich fürs Schmunzeln und erklärte wortreich, es bestünde kein Untermietverhältnis. Der Stempel auf dem Dokument war gefälscht, bzw. es war das alte Logo der WBS. Auch wenn ich mich später mit der Frau wegen der Kälte in meiner Wohnung angelegt habe, war ich Ihr sehr dankbar dafür, dass Sie mir die Wohnung in der Rigaer Straße vermittelte. Diese sollte gar nicht mehr vermietet werden, da das Haus verkauft werden würde. Das geschah aber vorerst nicht, denn ich wohnte dort dann noch zehn Jahre. Ja, auch diese Wohnung war günstig.
 Es war eine Wohnung im ersten Hinterhof mit Blick auf eine Wand im 4. Stock des Altbaus. 250 DM, Kohleheizung, Klo, Dusche, Küche. Tatsächlich wartete die Wohnung mit einem charmanten Schlauchbad auf. Die Dusche war eine Duschwanne im Eck mit Plastiksäcken statt Fliesen an eine Rigipsplatte geklebt. Die Erklärung des Vormieters bei der Besichtigung war, dass man noch keine Zeit fürs Fliesen hatte.
Es war eine Wohnung im ersten Hinterhof mit Blick auf eine Wand im 4. Stock des Altbaus. 250 DM, Kohleheizung, Klo, Dusche, Küche. Tatsächlich wartete die Wohnung mit einem charmanten Schlauchbad auf. Die Dusche war eine Duschwanne im Eck mit Plastiksäcken statt Fliesen an eine Rigipsplatte geklebt. Die Erklärung des Vormieters bei der Besichtigung war, dass man noch keine Zeit fürs Fliesen hatte.
„Ah. Verstehe. Wie lange habt ihr hier zu zweit in der Einraum-Wohnung gewohnt?“
„Das waren so drei Jahre, glaube ich. Oder Schatz?“
Eine summende Bestätigung. Die Fliesen lagen auch schon da, wie er mir zeigte. Und tatsächlich würde es eine nicht zu nennende Zeitspanne dauern, bis sich das änderte sollte. Das Bad war vielleicht so etwas wie eine Attraktion, aber im Sinne eines Gruselkabinetts mit dem Titel: “Das Grauen des Badezimmers in der Rigaer Straße”. Das empfanden die Leute womöglich auch wegen der fehlenden Heizkörper.
Der Boiler nahm mit seinem 80-Liter Fassungsvermögen das Sonnenlicht und das Stromkabel streckte sich ohne durchzuhängen bis zur Steckdose durch die Nasszelle. Eine Toilette nahm auf ihrer Höhe den Raum ein, sodass man nur auf schlankem Fuß die Dusche überhaupt erreichen konnte. Aber die Wohnung war toll und sie hatte eine ausgesprochen moderne Attraktion. Es wurde allgemein darüber gestaunt, dass die Fenster in der Kohlenheizungswohnung neu waren. Alle eilten sofort zu den Fenstern und lobten ihre Dämmung. Allerdings, wie im Beitrag zum Wohnen im Wilden Osten dargelegt, war das nur wenig hilfreich.
Nun lebte ich hier also in der Rigaer Straße. Die Gebäude waren ein Mix aus Ost-Bauweise und vor allem Altbauten. Wenig renoviert und man hatte immer viel Platz zum Parken. Die Leute, die hier wohnten, hatten womöglich aus Geldmangel keinen Bock auf ein Fahrzeug. Entlang dieser Straße sammelte sich das alternative Leben und vor allem eines: Kreativität in allen Formen und Variationen. Ich fühlte mich hier richtig wohl. Es waren paradiesische Zustände von Leben und Leben lassen. Das zog leider auch den Neid der prügelnden Nazis auf sich. Die Geschichte von Silvio Meier hallte noch lange nach, selbst noch Jahre später, als ich in diese Ecke zog.
Der Wandel hatte die Zeit erfasst und die Rigaer Straße, das bemerkte ich auch erst später, war einer der letzten Hoffnungsschimmer für die alternative Szene, die jetzt mit den althergebrachten Mitteln des Kapitals in die Räumungsknie gezwungen wurde. Das sollte aber erst noch die graue Zukunft werden und die prangte zu der Zeit von zahlreichen Fassaden. Die Zahl 2000 ergänzte viele Firmenschildern. Einige Beispiele existieren immer noch und ich fragte mich damals, ob die dann irgendwann 3000 oder 2.500 daraus machen würden. Und ja, es gab tatsächlich irgendwo kurz einen Laden mit 3000. Diesen ersten Deut des Wandels trugen einige türkischstämmige Geschäftsleute in die Rigaer Straße.
In der grauen Rigaer Straße leuchtete fortan ein gelbes Schild mit der Aufschrift: “Bäcker 2000”. Im Dunkel der Nacht lotste es mich durch die stillen Straßen des Nordkiezes. Es war nicht der erste Späti in diesem Abschnitt der Rigaer Straße, aber der erste, der auch nach Ladenschluss auf hatte. Das verhieß gerade zur Zeit der kalten Winter kurze Wege für das Bier nach Ladenschluss. Der Ladenschluss war in den 90er Jahren übrigens um 18 Uhr oder 19 Uhr, obwohl die Arbeitszeiten bald dem neoliberalen Zeitgeist geopfert wurden. Per Kneipengang war auch im Nordkiez die Bierversorgung kein Problem. Schon damals war es möglich, zu jeder Tag- und Nachtzeit ein Bier zu bekommen, wobei 24/7 gab es auch nicht. Das machte denn auch den Charme von Berlin aus: Es gab keine Sperrstunde und im Nordkiez von Friedrichshain hatten viele alternative Projekte eine Kneipe in Selbstorganisation.
Allein in der Rigaer Straße, vom Bersarinplatz bis zur Samariterstraße, versammelten sich sieben oder acht Kneipen. Manche existieren noch heute, andere haben offiziell „nie existiert“. Es war eine Folge des Booms der Kneipen im Südkiez, in der Simon-Dach-Straße, glaube ich. Vielleicht war es auch umgekehrt. Das ist mir entfallen. Zwar standen, glaube ich, hinter allen Kneipen Kollektive, aber sie variierten dennoch. Im Epizentrum war der Fischladen. Er bot die ganze Palette an alternativem Leben. Es gab Partys, es gab Vorträge, es gab Vokü … VoKü ist das Kürzel für Volxküche, falls es unter den geneigten Ohren Unwissende gibt. Die Vokü (ist? Oder) war eine segensreiche Institution, die leider von behördlicher Seite bekämpft wurde. Im Ursprung als Armenspeisung gestartet, war es in den 90er Jahren eine Möglichkeit, billig und nahrhaft zu speisen. Denn auch für jene Unwissenden diese Worte: In der Vokü kochte ein Team etwas Vegetarisches oder Veganes und verkaufte den Tellerinhalt für ein bis drei DM. Und wenn der Teller leer war, konnte man auch noch einen Nachschlag holen. Heidewitzka, das war Luxus! Ein weiteres Plus war das günstige Bier. Überhaupt trank man im Nordkiez schon immer günstiger als im Südkiez. Noch Jahre nach der Euro-Einführung konnte man ein Bier für einen Euro bekommen. Die Marke kann man sich natürlich denken. Also wir reden hier nicht von Späti-, sondern von Kneipenpreisen. Bier war entsprechend ein häufiger Begleiter beim Bar-Hopping. Vielleicht wurde in der Rigaer Straße auch das legendäre Berliner Wegbier erfunden. Gut, das könnte sich auch auf dem Boxi zugetragen haben. Die Punkszene, wie der aus den 80er Jahren übertragene Begriff für die alternative Szene lautet, gab Berlin nicht nur seinen sexy Charme, sondern war seiner Zeit voraus und warnte schon damals vor den Folgen dessen, was noch als Globalisierung durch die Medien geisterte.
Wie nur die Überlebenden berichten können, muss man bei der VoKü-Geschichte der 90er Jahre auch dazu sagen, dass das Rauchen überall nicht nur erlaubt, sondern von allem auch ausübt wurde. Gerade im Fischladen gab es Abende, da konnte man den Nachbartisch nur noch erahnen. Die im Kreis arrangierten Sitzmöbel waren ausrangierte Couches, zuweilen ihres Sitzkomforts komplett beraubt. So sehr, dass einzig die Lehne ein schmerzfreies Sitzen erlaubte. Bevor man sich hinsetzte, musste man die Aschenbecher-Lage inspizieren und diese umringten dann aus Platzmangel nicht selten den Teller. Fairerweise muss man dazu sagen, dass nicht alle die Aschenbecher nutzten, einige gaben sich auch mit dem Teppich zufrieden. Andere nutzen leere Bierflaschen, zumindest ging der eine oder die andere davon aus. Einen weiteren Geruchsfaktor stellten die Hunde dar, aber das ging meist unter. Aber der Geruch zahlreicher Bierverluste, das Bukett nikotiner Überreste und die müffelnden Hunde erregte sogar die Magensäfte der hartgesottensten Punks. Ich beobachtete eine Person nach einer ausgelassenen Nacht, die aus dem Alkohol-Koma hochschreckte und sich naserümpfend einen neuen Platz suchte. Ich weiß nicht, wieso, aber ich wollte es auch nicht herausfinden.
Das Samacafé in der Samariterstraße war in etwa dasselbe Genre, jedoch war die Ausstattung besser. Hier versammelten sich vor allem Stammgäste. Und es bot ein ganz interessantes Feature: Es verfügte über eine Tanzfläche. Es war auch weniger punkig als noch mehr auf Kreativität bedacht. Das konnte man auch damals schon an der Fassade ausmachen. Weiter in Richtung Bersarinplatz stand das Filmriz. Eindeutig meine Lieblingskneipe. Günstiges Bier und super Musik. Anfangs konnte man auch Billard spielen. Ich weiß nicht, warum der entfernt wurde, aber danach gab es deutlich mehr Platz. Auch hier gab es viel Stammpublikum, aber nicht nur. Das Bier drei Mark und eine Zeit lang konnte man sogar für 2 DM (?) brunchen. Es gab natürlich nur Kaffeemaschinenkaffee, Brötchen, Tomaten, Gurken, Wurst und Salz – aber es war toll. Wie es der Name schon andeutet, liefen hier Filme. Meist waren es Indiefilme, die man sonst nirgends sah. Aber auch Dokumentationen über die Missstände der Welt flimmerten über die Leinwand.
Und die Kollektive taten das, was alle gute Nachbarn machen: Sie verzankten sich auch mal. Dabei war das schärfste Schwert im Battle um den richtigen Weg, ein Aufruf zum Boykott. Da aber alle ihre eigene Kneipe hatten, war das sowieso überflüssig und jene wie wir, die sich nirgends zugehörig fühlten, war es gleichgültig. Zumal allen der links-punkische Ansatz mitgegeben waren und selbstredend man überall günstig trinken konnte.
Noch mehr Charme und Kreativität boten die Kneipen „Kadterschmiede“ und „Durchs Fenster“ auf. Natürlich rührte der Name dieser einzigartigen Location namens ‚Durchs Fenster‘ vom Eingang her. An der Liebigstraße stieg man einfach durch das Fenster und stand in einer Bar. Ein Besuch von mir redet noch heute davon. Das Konzept war einfach überzeugend. Vier einfache Wände von punkig, alternativer Musik erfüllt und mit Reihen Bierbänken befüllt. Das kaum zu toppende Angebot betraf den Bierpreis mit einer DM zu beziffern war. Bei dem Preis musste man ja investieren. Natürlich ist das Gesöff gemeint, das bis heute zum billigsten Fusel gehört, den man für Geld in einem Supermarkt kaufen kann. Dem Durchs Fenster ermangelte es im Gegensatz zur Kadterschmiede nebst breit angelegter politischer Aufklärung etwas Wichtigem: der VoKü.
In der Kadterschmiede gab es das des Öfteren. Sie war politisch aktiver als andere und stand in Verbindung mit dem Xbeliebig. Hier sammelten sich die Kräfte, die sich dem neoliberalen Wandel nicht ergeben wollten. Das “Durchs Fenster” und die Kadterschmiede ereilten jedoch ganz unterschiedliche Schicksale. Die Kadterschmiede wurde spektakulär geräumt. Ich glaube sogar mehrfach. Ich kam eines Tages sogar zu spät zum Seminar, weil die Polizei die Rigaer Straße absperrte und ich nicht an ihnen vorbei kam. Ich wohnte gegenüber dem Haus. Während das Durchs Fenster wenig aufsehenerregend irgendwann weg war.
 Aber die Partys der Kadterschmiede waren legendär, vor allem die eine. Mit Flyern war eine Party unglaublichen Ausmaßes beworben worden. Es war ein schöner Sommertag, als es begann – an einem Donnerstag Mittag. Die Zeichen der Party waren schon bemerkbar. Das Wummern von Musik vor dem Haus, die Betrunkenen und ein kleines bisschen mehr an Leuten waren die Vorzeichen. Diese Merkmale würden sich über die nächsten Tage verstärken. Zum Höhepunkt füllte sich die Straße, die ganze Nacht hindurch mit Feierfreudigen. Die Lärmbelästigung durch die Musik hielt sich aber in Grenzen. Ich wohnte gegenüber und in meinem Hinterhof kam von der Party nur noch der Geruch körperlicher Erleichterung an. Dass die Leute auf der Straße waren, war tatsächlich kein großes Drama. Das muss ich vielleicht erklären. In den 90er Jahren gab es viel weniger Verkehr in der Stadt. Auf der ganzen Rigaer Straße zwischen Proskauer Straße und dem Bersarinplatz, der damals noch von braun-grauen Plattenbauten bestimmt war, standen vielleicht 20 Autos. Ein gutes Viertel war vermutlich kaum noch fahrtüchtig. In so manchen Hinterhöfen rosteten Fahrzeuge der vergangenen Jahrzehnte herum. Zwischen der Rigaer Straße und Liebigstraße, wo die Säulen den Verkehr der Frankfurter Allee freigeben, gab es einen zugehbaren Keller, der wie eine unbefahrbare Tiefgarage wirkte. Denn über einem Vorsprung fehlte eine Wand zu diesem Kellergeschoss, auf dem kein Haus stand. Es war einfach eine Brache, wie noch über Jahre bestand. Der Schimmel hing von den Decken und selbst darin waren alte Autos zum Verrosten abgestellt worden. Ich fragte mich nur, wie sie die Autos da rein bekommen hatten.
Aber die Partys der Kadterschmiede waren legendär, vor allem die eine. Mit Flyern war eine Party unglaublichen Ausmaßes beworben worden. Es war ein schöner Sommertag, als es begann – an einem Donnerstag Mittag. Die Zeichen der Party waren schon bemerkbar. Das Wummern von Musik vor dem Haus, die Betrunkenen und ein kleines bisschen mehr an Leuten waren die Vorzeichen. Diese Merkmale würden sich über die nächsten Tage verstärken. Zum Höhepunkt füllte sich die Straße, die ganze Nacht hindurch mit Feierfreudigen. Die Lärmbelästigung durch die Musik hielt sich aber in Grenzen. Ich wohnte gegenüber und in meinem Hinterhof kam von der Party nur noch der Geruch körperlicher Erleichterung an. Dass die Leute auf der Straße waren, war tatsächlich kein großes Drama. Das muss ich vielleicht erklären. In den 90er Jahren gab es viel weniger Verkehr in der Stadt. Auf der ganzen Rigaer Straße zwischen Proskauer Straße und dem Bersarinplatz, der damals noch von braun-grauen Plattenbauten bestimmt war, standen vielleicht 20 Autos. Ein gutes Viertel war vermutlich kaum noch fahrtüchtig. In so manchen Hinterhöfen rosteten Fahrzeuge der vergangenen Jahrzehnte herum. Zwischen der Rigaer Straße und Liebigstraße, wo die Säulen den Verkehr der Frankfurter Allee freigeben, gab es einen zugehbaren Keller, der wie eine unbefahrbare Tiefgarage wirkte. Denn über einem Vorsprung fehlte eine Wand zu diesem Kellergeschoss, auf dem kein Haus stand. Es war einfach eine Brache, wie noch über Jahre bestand. Der Schimmel hing von den Decken und selbst darin waren alte Autos zum Verrosten abgestellt worden. Ich fragte mich nur, wie sie die Autos da rein bekommen hatten.
Selbstverständlich war ich auch auf der Party und mich erwartete die vermutlich größte Hausparty, die ich je erlebt habe. Die Feierzone erstreckte sich, soweit ich mich richtig erinnere, über einen Großteil eines Blocks. Über geschätzte zwei oder drei Häuser hinweg reihten sich Tanzflächen und Bars. Wie viele Räume es waren, ließ sich nicht nur anhand der sich drängenden Menschenmassen und der vielen angesteuerten Bars nicht mehr beurteilen. Die Kellerräume waren denn gar nicht leer. Es stand, wo man ging und saß Krempel herum. Die Orientierung fiel dem auch zum Opfer.
Ich nehme an, der Aufbau war so aufwendig, dass die Party sich lohnen musste. Vor dem Hintergrund nahm die Party fast biblische Ausmaße an. Und so feierten die Brüder und Schwestern des wahren Glaubens über ein verlängertes Wochenende hinaus. Halleluja. Andere mokierten sich darüber, dass es ausgeufert sei. Aber die Jugend nahm sich das Recht.
Mag sein oder mag nicht sein, dass es in jenen Tagen dieser Party war, da ich der Person begegnete, die mir das verklärt-harmonische Friedrichshain mit seinem Gift des Betrugs madigmachte. Peter lief eines Tages auf der Frankfurter Allee herum. Ich glaubte meinen Augen nicht zu trauen. Ich fasste mir Mut und mit pochendem Herzen stellte ich ihn kleinlaut zur Rede. Peter herrschte mich an: “Wie? Ich schulde Dir 1.000 DM? Du hast meine ganzen Sachen weggeworfen!”
Tatsächlich hatte es mich zwei Tage gekostet, den ganzen nach Kippen-stinkenden Schrott in den Müll zu werfen. Der versprochene Fernseher war defekt und nicht erst seit gestern. Das Bettzeug war vergilbt und die klebenden Überreste von gefühlten 100 Jahren Rauchen bei geschlossenem Fenster wären bei keinem Einbruch, geschweige denn einem Flohmarkt weggekommen. Ich hatte ihn auch bei der Polizei angezeigt. Die ermittelten und kam zum Schluss: “Naja, wech is wech. Wat willste machen.”
Mir war es jedoch eine Schadenfreude zu sehen, dass sein Palmentraum nicht so verlief wie geplant. Ein wenig Gerechtigkeit in der prärechtsfreien Raum-Zeitkoordinate, denn die Polizei war an der Information seines Aufenthalts in Berlin so wenig interessiert wie ich an den Beschwerden der Nachbarn in puncto Party in der Kadterschmiede.
Und warum wohnt der Verfasser dieser Zeilen nicht mehr in der Rigaer Straße? Auch bei mir klopfte eines Tages der Kapitalismus an die Tür. Das Haus wurde verkauft und es sollte renoviert werden. Der Klassiker. Wir waren eines der letzten Häuser in diesem Abschnitt der Straße – von den Hausprojekten und den Brachen abgesehen. Das Haus wurde in ein Gerüst gepackt und die Bauarbeiten begannen. Von morgens bis abends. Aber es war nicht nur der Lärm, es war der Staub, der Dreck und dass man außerhalb der eigenen vier Wände auf einer Baustelle wohnte. Ja, die eh schon sehr hohe Wohnqualität war stark beeinträchtigt. Immer mehr Mietende verließen das Haus. Zuerst die Familien, dann die alten Leute und dann der Rest. Bis auf die Familien sprachen alle davon, dass man hier Geld machen kann. Auch ich kannte Leute, die aus ihrem Mietvertrag herausgekauft wurden. Es lockten mehrere Tausend Mark.
So sehr das Geld auch lockte, ich gab bald auf. Einer wollte durchhalten. Einer wollte mit seinem Hund die Stellung halten und sich auslösen lassen. Er lebte da schon als ich eingezogen bin und auch noch, als ich das Handtuch warf. Jahre später traf ich ihn. Ich fragte ihn: “Hast Du Geld gesehen?”
Was denkst Du, war seine Antwort?






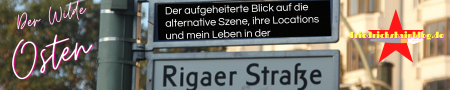








Den Bäcker 2000 gibt es doch immer noch, oder?
Denke schon. ..
Am Kiosk vor der Samastr haben wir viele schöne Stunden verbracht!
Das ist meine Lieblingsgeschichte aus Deiner Kolumne! Lebte auch in der Rigaer Straße und erinnere mich gerne an die alten Zeiten…
Seine Antwort war vermutlich nein, wenn schon so gefragt wird… Aber ich kenne tatsächlich einige Leute, die eine Abfindeung für den Mietvertrag erhielten.