Der Wilde Osten: Rock-Party im Berlin der 90er Jahre
Die Party war das Lebenselixier des Wilden Ostens in den 90er Jahren. Die Legenden und Sagen dieser Zeit des Wilden Ostens möge man mit Vorsicht genießen und keinesfalls daheim nachahmen. Da gab es Vorfälle … Es mutet geradezu religiös an, wenn man die vielen Rituale bedenkt.
Zum besseren Verständnis des nachfolgenden Erlebnisberichts empfiehlt es sich zunächst die anderen Beiträge zum Wilden Osten, Ost-Berlin in den 90er Jahren, zu lesen. Klicken Sie das nicht existierende Kästchen an, wenn Sie damit einverstanden sind. Falls Sie nicht einverstanden sind, wird der Text in den nächsten Sekunden verschwinden. Wenn nicht, sind Sie auserwählt, diesen Text dennoch zu lesen. Die Kriterien der Auswahl sind rein willkürlich und können nicht beim Datenschutzbeauftragten reklamiert werden. Gute Nacht.
Aber vielleicht noch eine kleine Gute-Nacht-Geschichte, wie Mama und Papa früher ihre Jugend verschwendeten? Kurz gesagt mit Party. Aber was bedeutete denn eigentlich die Party in den 1990er Jahren? Was waren die Rituale dieser Religion? War es das Kennenlernen neuer Leute? War es das Feiern der eigenen Existenz? War es der Rausch? Mehrfachnennungen sind möglich.
Und Berlin hatte in Partybelangen einen Ruf, der ja nicht ganz von ungefähr kam. Das war der Sex im armen, aber sexy Berlin. Deswegen wollten die Menschen hierherkommen, deshalb kamen die Kreativen, und infolgedessen wurde Berlin ein Hotspot der Startup-Szene. Es war das Lebensgefühl dereinst, das zu fühlen man wohl in dieser Stadt zu dieser Zeit gewesen sein musste. Es war vermutlich der alte Partygeist der 68er Bewegungen, den Dr. Motte mit der Loveparade in neue Schläuche von elektrischen Beats und Sounds füllte. Ja, es war ein weiter Weg von Kraftwerk bis zum BigBeat, House und meinetwegen auch Techno der 90er Jahre. Und mit Party ließ sich Geld verdienen. Schließlich kamen nicht wenige Tourist*innen nach Berlin, um in dieser Clubkultur zu baden. Es war das günstige Wohnen, das diesen Mikrokosmos schuf. Aber genug der Anklage an die Gegenwart. Begeben wir uns in den süßen Traum der glitzernden Nostalgie.
Ich erinnere mich an eine Partynacht, die in vielerlei Betrachtungsweisen eine Stereotype sondergleichen war. Ich muss von dieser Jugend getrieben worden sein, von der man so viel hört. In der Abwechslung von Rauchen und Tanzen, Reden und Schweigen erging ich mich im Menschendienst, im modernen Gebet der heiligen Feier der eigenen Existenz. Übrigens musst Du mal zum Sonnenaufgang auf einer Tanzfläche im Freien und das im Zustand von Glückseligkeit beten, das wird ein Moment für die Top Ten des Endes sein. Und da ich mich so erquickte, vergaß ich die Zeit. Aber die Zeichen des jähenden Endes waren die immerselben: Die Musik verstummte und ein unheiliges Licht zerstörte den diskreten Geist des Tanzparketts. Durch den illuminierten Ausgang musst Du Dich begeben, Dich dem Wind, der Kälte und vor allem der nüchternen und verachtend-blickenden Bevölkerung eines Sonntagmorgens stellen. Helllichtes Tageslicht fällt auf Dein Antlitz, dem alle entnehmen: ein Tagedieb, ein Tu-nicht-gut, ein Partygänger. Man könnte meinen, immer mehr Familien mussten ein solch verdammenswertes Familienmitglied in den eigenen Reihen aushalten. Aber in Berlin war es einfach normal. Es gehörte zum Straßenbild wie ein Kruzifix in einer bayrischen Behörde. Den Eindruck, nicht ganz normal zu sein, erweckte Berlin schon früh bei mir, wie ich mit dieser eingeschobenen Geschichte kurz darlegen möchte.
Es war an einem warmen Sommerabend in der Oranienstraße. Damals gab es in der Straße noch die Milchbar (soweit ich mich recht entsinne). Es war schon spät geworden und wir steuerten auf einen Club zu, der schon bald das Handtuch werfen würde: das Trash. Dort ist heute das Hotel Orania, wo es früher immer gute Metalmusik gab. Besonders freitags war es ein schöner Ort für das Gebet. Auf der Kreuzung davor stand eine ältere Frau, deren Gekreische durch die damals noch wenig befahrenen Straßen schallte. Je näher man der Frau kam, desto mehr verstand man die Worte, jedoch ohne eine Sinnproduktion. Erst dachte ich, sie hätte es auf jemandem in einem Haus abgesehen, da sie nach oben schrie. Aber nein, es war die Ampel, die ihren verbalen Zorn zu spüren bekam, und zwar ausdauernd. Ich schaute ihr zehn Minuten zu, sie schrie sie schon an, als wir die Szenerie betraten, und eben auch noch, als wir den Club einige Minuten später erreichten. Ganz sicher wäre mir das nicht im beschaulichen Dorf widerfahren.
Ein anderer Club, ein anderer Bezirk und das Licht als Ende des Sakralen, als ich eines nächtens bzw. morgens durch den Deckenfluter zum Gehen aufgefordert wurde und das Portal in die reale Welt durchschritt. Doch die heilige Mission fand eine Mitstreiterin. Die Sonne war zwar schon wach, aber der Geist noch willig. Die Lösung lautete: „BlaBla“. Nein, das ist kein Platzhalter für die Bar, die mir nicht mehr einfällt. Es war die Bar mit Namen BlaBla. Wie ich diese Worte schreibe, fällt mir auf, dass dieser Gedankengang vielleicht zur Namensfindung beigetragen hatte.
Die Vorteile dieser Bar lagen auf der Hand: Sie war in der Nähe und hauptsächlich war sie 24 Stunden lang offen. Also huschten wir in den frühen Morgenstunden um kurz vor sechs Uhr die Dunckerstraße hinunter über die Danziger in die Knaackstraße. Es vergingen tatsächlich weitere Stunden, bis der Partygeist sich meiner entledigte und mich müde und ermattet zurückließ. Als wir abermals die Tore zur Realität durchschritten, war es fast Mittag und die Sonne blendete erbarmungslos das an Dunkelheit gewöhnte Auge. Mit den Händen erhob ich mir eine Barriere, um dem grellen Licht zu entgehen. Just in diesem Momente kam eine Gruppe Tourist*innen, von einem älteren Tourguide angeführt um die Ecke. Als er schnellen Schrittes an uns vorbeizog, fielen folgende Worte: „Wie zum Beweis sehen Sie hier zwei Exemplare dieser Partykultur, die Berlin erfasst hat.“
Dabei war Berlin natürlich vom Techno-Mosquito gestochen. Für mich war aber der Prenzlauer Berg die beste Anlaufstelle für den wochenendlichen Menschendienst. Früher gab es noch den Knaack und den Magneten in der Greifswalder Straße. Das führte oftmals zu Missverständnissen, wenn jemand der Entfernung wegen zu spät kam und meinte, „Ich dachte, der Knaack-Club wäre in der Knaackstraße“, was er selbstverständlich nicht war. Der Senefelder Platz ist ja auch nicht an der Senefelder Straße. Die damals so kahlromantische Greifswalder Straße hatte, wie die Warschauer Straße, den ganzen Charme des Ostblocks in sich aufgesaugt. Doch die Clubszene war legendär. Und so machten wir uns zu zweit auch eines Tages zu einem dieser Läden in der Greifswalder auf.
In der Dunkelheit gab es hier, trotz hellster Beleuchtung, nichts zu sehen. Einzig die lärmenden Freunde der Party suchten diese Straße fast allabendlich heim. Schließlich sah der Gebetskalender in der Woche den Knaack-Club am Mittwoch und den Magnet am Donnerstag vor. Aber jener Tag, von dem ich nun berichten will, war ein Samstag. Die bleichen Häuser schimmerten rötlich in dem Licht der früheren DDR-Straßenlampen und das karge grüne Etwas, das aus Betonfassungen mutlos herausgriff – als hätte die Pflanze beschlossen, sich der umgebenden Tristess anzupassen – stellten das Bühnenbild.
Davor erstreckte sich ein etwa 5 Meter langer und unausgeleuchteter Abschnitt. Der Mann vor uns, den man landläufig als Lulatsch bezeichnen würde, betrat diesen Bereich des Schattens. Wir gingen in einem Abstand von etwa vier Meter hinter ihm, als aus beschriebenem Busch ein Mann auf diesen Typen vor uns losspringt. Mir schien, als hätte er eine Waffe gehabt, mit einem beherzten Schlag wurde er entwaffnet. Der Blickwechsel war im Dunkeln, aber durch den Höhenunterschied verkehrte sich die Situation. Der Angreifer war etwas kleiner als der Durchschnitt und der Angegriffene reichte sicherlich an die zwei Meter heran. Die proportionale Belustigung fand darin aber nicht ihren Höhepunkt.
In dem Handgemenge machte sich die überlegene Höhe schnell bemerkbar und das begann auch der Angreifer zu realisieren. Er prüfte mit einem Blick die Umgebung und machte sich mit einem Sprung über die Böschung auf, den Fluchtweg anzutreten. Der Angegriffene, der uns nicht eines Blickes würdigte, kommentierte den Ausreißer: „Det könnte Dir so passen!“ und sprang hinterher. Im Dunkel der Nacht verlor sich die Szenerie, sodass ich nicht weiß, ob er ihn gekriegt hat und was er mit ihm angestellt hat. Aber er holte relativ schnell auf mit seinen langen Beinen.
Ja, Berlin war zuweilen ein raues Pflaster. Vor allem, wenn man aus der behüteten und verständnisvollen Umgebung der Universität kam. Es war das junge, aber letzte Jahr des Jahrtausends, als sich folgende Geschichte begab. Die Uni-Zeit war durch ein freundliches Miteinander bestimmt. Durch den Geist der Forschung und nicht der Leistung. Das gibt es seit dem Bachelor nicht mehr, von dem ich freilich nicht mehr so viel mitbekommen habe. Wenn alle so schrecklich nett zu Dir sind, dann lässt Du die Schilde fallen. Dazu gehört es auch, laut zu werden. Behalte das mal in Hinterkopf, okay?
Mein Musikgeschmack traf bei einigen Kommilitonen auf Gegenliebe und es empfahl sich eine Bar in Kreuzberg. Ich war also freundlich, ich war es gewohnt, dass mir Freundlichkeit begegnet. Keine Vorgesetzten, die brüllten, kein Entsetzen darüber was die Nachbarn wohl sagten, kein ‚Das wird Konsequenzen haben, junger Mann‘. Die Welt war lieb geworden. Ich war aber auch jung und leicht zu beeinflussen.
Ich betrat diese Bar, in der wir uns treffen wollten. Sie hieß und es gibt sie immer noch: „Wild at Heart“. Eine Bar für Freunde der härteren Rockmusik. Ich muss sagen, es ist eine der besten Bars, die man in Kreuzberg finden kann. Mit der Tür eröffnete sich ein kleiner Raum, der zu einer Bar auf einer Empore führte. Der hellste Ort, vielleicht, damit der doppelte Blick besser ins Ziel führt, die Bar. Als ich in den Raumdunst eintauchte, zog der Rauch unzähliger Kippen sofort in meine Kleidung. Als hätte er auf mich gewartet und in Geiselhaft genommen, aber ohne eine Lösegeldforderung zu stellen.
Ich nahm mir Mütze und Schal ab, als ich an die Bar trat. Der schwitzende und selbstverständlich stark tätowierte Mann mit Bart und nach hinten gekämmten Haaren brüllte mit selbstbewusst lauter Stimme: „Was willst Du?“.
Der Clash of Cultures, die der Umgangsgepflogenheiten der Universität und die in einer Kreuzberger Rockbar kämpften in meinem Kopf, und ich verlor dabei. Also gab ich kleinlaut „Ein Bier“ zu verstehen, doch verstanden hatte der gute Barmann gar nichts. Dem Fährmann über den Styx gleich beugte er sich weiter in meiner Richtung und verstärkte sowohl Lautstärke als auch die Adern auf seiner Stirn mit Blut: „Was willst Du denn jetzt?“
Wie in einem schlechten Collegefilm waren alle Augen auf mich gerichtet. Und wie beim Looser in besagten Filmen blieb die Wirkung der Szenerie nicht aus. Als ich meine Bestellung wiederholte, versagten mir die Stimmbänder den Dienst. Meine Stimme überschlug sich und verunfallte am Berg des energisch-angestrengten „Waaas?“. Mit rotem Kopf und zusammengestauchten Stimmbänder quälte mir es erneut heraus, um dann mit eingezogenem Kopf schnell wegzugehen und das Bestellen den anderen zu überlassen.
Aber zurück zu der Art und Weise, wie man in den 90er Jahren Party machte. Wie das obige Beispiel darstellt, verabredete man sich lange vor dem Tag. Daher mussten Treffen geplant werden, seltsam aber so steht es im Telefonbuch geschrieben. Ohne die segensreiche Kommunikation in Echtzeit planten die Menschen im letzten Jahrtausend ihre Wochenenden vorher. Sicherlich gab es die durchaus probate Möglichkeit, einfach bei den Leuten vorbei zu fahren und zu schauen, ob sie da wären. Das ist selbstredend mit Zeit und Anstrengungen verbunden und war in Berlin weder gang noch gäbe. Etwas, das heutzutage sowieso nur noch in Bezug auf Arbeit geleistet wird. Die Leute damals eben. Schon irgendwie niedlich mit ihren Prä-handy-Kommunikationsarten, aber so warens die Wilden 90er. Damals kannte man natürlich schon das Telefon. Darüber hat man sich natürlich auch verabredet, nur konnte man das nicht mitnehmen. Aber was, wenn man gerade einkaufen ist, wenn jemand anruft? Was beim Donnerlittchen dann? Dafür gab es die segensreiche Erfindung, die man AB nannte. Das ist nicht Atom-Biologisch und es hat auch niemand das C vergessen und mit Google hat es nun sicherlich gar nichts zu tun. Die Buchstaben AB stehen als Kürzel für Anruf-Beantworter. Das war ein Gerät, so groß wie ein Tablet und hatte dafür genau so viele Knöpfe. Es anzuschließen war eine Kunst für sich selbst, aber beim Besprechen konnte man seine ganze Kreativität beweisen. Ein Beweis, den die Anrufenden immer bis ganz zum Ende anhören mussten, um ihre Nachricht zu hinterlassen. Es war so schade, dass bei den normalen Geräten die Ansage bei einer Minute begrenzt war. Man hätte doch noch einen Absatz französische Lyrik oder ein Musikstück einer bekannten Gruppe nutzen können, um die Ansage zu individualisieren. Eine Minute, die man bis zum Schluss anhören muss, um kurz zu sagen: „Ich bins, ruf mich bitte zurück“. Eine Minute, die – wenn man es nicht durchhält, und man wieder anruft – erneut beginnt. Gut, bis das Band durchgespult ist, war die Leitung belegt. Erst danach konnte man einen neuen Anlauf starten. Ach ja, Bänder meint aufgerollten Daten, die nicht digital sind, sondern tatsächlich noch akustisch aufgenommen wurden.
Damals sprachen die Menschen noch die Sprache der Computer, heute ist das Wissen irgendwie verschüttet gegangen. Damals herrschte auch noch eine andere Religionseinteilung vor, deren Strukturen heute noch nachwirken. Eine Ökumene kaum denkbar und dabei schon längst praktiziert. Es gibt den einzig wahren Musikglauben, der aus handgemachter Rockmusik besteht. Es gibt die alles reformierenden Glauben an eine Musik aus der Konserve, die zunächst in Rhythmen gezwungen war und sich nun längst über alles hinweg ausgebreitet hat. Ihre Gegensätze brachten neue Gläubige hervor und so verläuft das Spiel schon seit Generationen hinweg, vielleicht auch schon immer. Und mit ihr sind sie unterwegs. Jene Brüder und Schwestern, die den Ruf des Gebets vernommen haben. Jene, die die Existenz in den zahlreichen Tempeln der Party zelebrieren. Jene, die man die Jugend (und drum herum) nennt. Jene, die auf das Heilige Licht zugehen, bis es wieder von einem fernen Stern kommt.
In Erinnerung an eine treue Begleiterin,
in der Erinnerung lebst Du gelegentlich noch fort.
Geliebte, zerstörende und erfüllende
Party!
Dein Hohepriester a.D.
Gehet hin in Frieden!






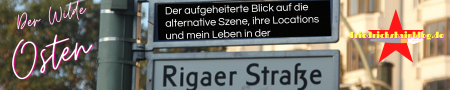









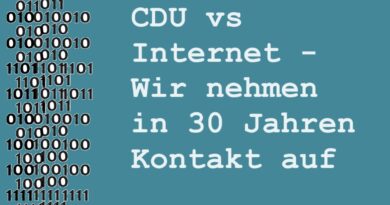



Superwitzig geschrieben!
Danke!