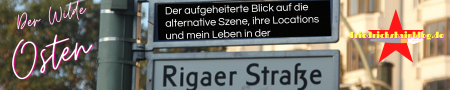Der Wilde Osten: True Partys – Tatort Zuhause und woanders
Die skandalöse Seite der Berliner Partys in der Postwendezeit. Geschichten voller Niedertracht, pikanter Details und des Verstoßes gegen die Sittlichkeit. Geschichten, wie sie sich nur in Ost-Berlin zutragen konnten. Erfahren Sie die ganze grauenvolle Wahrheit über diese verdorbenen Zeiten mit ihren verbrecherischen Individuen. Jetzt im Wilden Osten: exklusiv und ausschließlich hier auf Friedrichshainblog.de!
Heute bei Sendung mit dem Graus: Die Ausschweifungen der legendären WG-Partys in Ost-Berlin der 90er Jahre!
Det kommt jut, wa!
Das war Berlinerisch.
[Das Intro-Lied von Tatort]

Wenn Pflanzen einen Wassermangel aushalten müssen, bleibt ihnen allein die Hoffnung, dass das Wasser wiederkommt. Sie können der Situation ja bekanntlich nicht entfliehen. So ähnlich ergeht es den Partygebenden in einer WG und da bleibt immer was zurück. Im besten Fall ist es Müll und schöne Erinnerung, im schlechtesten Fall eine böse Ahnung und der Wunsch, die Zeit zurückzudrehen.
Es gibt aber andrerseits auch Leute, die drauf scheißen und wenn dann so jemand eine Party gibt, dann nimmt das ungeheuerliche Dimensionen an. Diese Geschichte handelt von einem Großaufgebot der Polizei, welches bezüglich des Abhaltens von Festivitäten meines Erachtens ein singuläres Vorkommen in den 90er Jahren war. Staunend, wie die intellektuell überlegene Fliege, die Wendler beobachtete, als er sein Verschwörungsvideo aufnahm, wurde ich Zeuge dieses spektakulären Zwischenfalls.
Die Zeit – es waren die Neunziger. Die Stadt – Ost-Berlin. Im einstigen Einzugsgebiet der Stasi suchten drei Partytiere nach Zerstreuung und Amüsement. Sie trafen sich in einer Bar. Eine Bar in der Gärtnerstraße, die bestimmt einen Namen hatte. Auf dem Tisch sammelten sich einige leere Flaschen Bier und die Frage des weiteren Verlaufs dieses ansonsten recht unspektakulären Abends schwebte ausgesprochen im Raum. Vorschläge wurden gemacht und allein ob der Distanz angesichts der fortgeschrittenen Zeit wieder verworfen.
„Vielleicht ist ja noch was auf der Party los?“, rief einer der Spaßgesellen aus.
„Das hättest Du ja auch mal gleich sagen können!“, war das Echo.
Einen Beschluss später waren wir auf dem Weg. Wenige Blocks trennten uns von der Kopernikus- oder Libauer Straße? Betörende Klänge wiesen uns den Weg zum Erlebnis – und was für ein Erlebnis. Als uns endlich Einlass gewährt wurde, die Party war lauter als die Klingel, waren nur noch wenige Vergnügungssüchtige vor Ort. Es war keine gediegene Party, auf der man dem Gastgeber oder der Gastgeberin einen Wein überreicht und sich für die Einladung bedankt. Nein. Hier kämpfte man sich durch Alkoholleichen, Müll und der ein oder anderen Person, die glaubte, sich im Rhythmus des Songs zu bewegen. Welche Kriterien bei Pogo dazu auch immer zählen.
Im Zentrum der Party angekommen, konnte man aber keine Boxen erkennen. Ihre bloße Existenz war nicht zu überhören. Es gab keine DJs, keine Anlage und keine Lautsprecher. Ein Rätsel, das zu lösen uns nicht gelang. Die Lautstärke in einem relativ kleinen Raum machte es unmöglich, die Quelle zu lokalisieren. Des Rätsels Lösung war dann, dass die Boxen in den Wänden versteckt waren und die Wand davor war frisch tapeziert. Die Frage, die der Gastgeber, den ich gar nicht kennenlernte, sich womöglich stellte, war: Kann die Polizei die Musik auch ausschalten, wenn sie die Quelle nicht herausfindet?
Wenige Minuten bevor die Party polizeilich beendet wurde, kam mir ein erfreuter Partygast mit zum Stoß erhobenen Bier entgegen: „Die Party ist der Wahnsinn!“, und hätte ich nicht an seinem Gesicht abgelesen, was er meinte, ich hätte es kaum verstehen können. „Die Bullen waren schon drei Mal da!“, feixte er.
Und schon traten uniformierte Kräfte auf der Party auf, und es machte den Eindruck, sie suchten nach der Musikquelle. Es folgte ein womöglich unangenehmes Gespräch mit dem Partygeber, der wiederum womöglich sein Ziel erreichte, denn die Polizei konnte die Stereoanlage nicht finden. Als wir gingen, war die Musik noch zu hören, wenngleich sie im Hintergrund verschwamm. Denn meine Augen verlangten meine gesamte Aufmerksamkeit. Die ganzen drei oder vier Stockwerke hinab blickten grüngekleidete und gepanzerte Männer und Frauen durch einen Plastikschutz auf mich. Sie standen links und rechts dicht hintereinander. Es war wie ein Ehrenspalier, das der Institution Party salutierte. Die unheimliche Situation motivierte mich, die Treppen so schnell wie möglich hinab zu gehen. Nur weg, bevor es sich die Staatsmacht anders überlegt und uns auch kassiert. Aus dem Haus getreten, atmeten wir freier – auch wegen der hohen Nikotinkonzentration in der Luft der Party. Während wir einen letzten Blick in den Partyabgrund warfen, konnte ich bestimmt zwölf Wannen ausmachen (wenn sich meine Erinnerung nicht irrt).
Die Lärmbelästigung war der natürliche Feind der Party, deren Habitat sich temporär besonders in WGs erstreckte. Es waren die schönsten Momente, die bis ins Gedächtnis gelangten. Die sommerliche Wahl bestand zwischen Fenster auf und ruhig sein oder den Qualm unzähliger Zigaretten zu atmen. Es gab natürlich die richtig Tapferen, die wenig Probleme damit hatten, dass die Polizei wegen des Lärms vorbeikommt. Wobei das obige Szenario seinesgleichen meiner Kenntnis nach immer noch sucht. Eben eine Singularität unter den vielen Partys, derer ich je Zeuge wurde. Noch heute werden an den Lagerfeuern in mancher Straße in Berlin Heldenlieder über diesen Event gesungen.
Ich weiß ja nicht, was sich während der Corona-Pandemie ereignete, aber wo die Party schnell der polizeilichen Aufsicht weichen musste, war eines Tages in den 90er Jahren in der Rigaer Straße. Die alternative Szene in der Rigaer Straße beschloss eine öffentliche Party auf der Proskauer Straße abzuhalten. Ich kam zufällig des Wegs und passierte die Partystraße mit einem in Alu-Folie verpackten Döner. Nicht, dass ich es eilig hatte. Nein, es wartete lediglich der alte Röhrenfernseher auf mich. Als ich die Kreuzung querte, fand ich mich in einer urigen Punkparty wieder. Es waren nicht wirklich viele Leute, aber die standen auf der ganzen Straße bis zur Rigaer Straße zwischen Bierkästen verteilt und lauschten selbstverständlich wohlig klingender Musik. Doch die Autos, die nicht mehr weiterkamen, störten das kleine punkische Tete-a-Tete. Sie hupten und hupten und dann dauerte es nicht lange, bis grün-weiße Kollegen das Feld betraten. Es war eine Kleinbus-Streife. Nur mal kurz die Augen schließen und folgendes träumerische Szenario zulassen: Eine Ansage: ‚Bitte räumt die Straße oder lasst zumindest die Autos durch‘, und die Leute hätten es gemacht. Doch, und man muss schon leider ‚wie selbstverständlich‘ sagen, kam es anders. Das VW-Buschen von Euer Gnaden Staat fuhr langsam heran. Sie stoppten nicht, sondern wendeten. Natürlich wurden die Feiernden auf diesen Manöverzug aufmerksam. Und, als wäre es ein seltendummer Reflex, schon erschallte ein Lied der Ablehnung. Der Polizeiwagen stoppte, er fuhr wieder an, er stoppte. Es hatte aber nicht mit dem Rhythmus der Musik zu tun, sie überlegten wohl, ob es klug wäre, auszusteigen. Sie taten gut daran, es nicht zu tun.
Ich setzte mich auf die Einfassung des kargen Grüns und beobachtete das Treiben. Auf meinem Schoß bereitete ich das Abendmahl aus und machte mich darüber her. Vor mir ein Pärchen von beginnender Volljährigkeit. Beide hatten eine Hand in der Hosentasche des Anderen stecken. Sie schienen ein Ideal von Liebe und Harmonie, als die Frau sich umdrehte und nach etwas suchte. Wie sich bald herausstellte, suchte sie nach einem Pflasterstein. Ich dachte noch: ‚Das würde sie doch nicht tun, oder?‘. Sie zielte, sie warf, sie traf und die Heckscheibe des Polizeiwagens splitterte mit dumpfem, aber lauten Klirren. Noch lauter waren die quietschenden Reifen der Polizei, die unter dem Jubel und Gelächter der Party davonbrauste. Es vergingen wenige Minuten, selbst ein Krankenwagen hätte mehr Zeit benötigt, bis die Party ein schnelles Ende fand. Es waren, ich weiß nicht wie viele Wannen und dieses Mal hielten sie. Aufs Kommando sprangen Polizeikräfte in voller Montur mit Helm, Schlagstock und Schild auf die Straße. Noch bevor die letzte Flasche Bier geleert war, stand die Linie der gepanzerten Zivilarmee. Schritt für Schritt wurde die Party aufgelöst. Niemand war so blöd, sich dem entgegenzustellen. Selbst der letzte Möchte-Gern-Rebell überlegte sich das im Angesicht der Übermacht. Der letzte Partygast war gegangen, doch die Polizeilinie hielt Kurs wie eine Welle im Meer. Aber da war ja nur noch ich auf der Grüneinrahmung sitzend und meinen Döner futternd. Die Linie kam mir immer näher. Sie werden doch verstanden haben, dass ich hier nur Zaungast bin? Gleichschritt für Gleichschritt rückte die knüppelschwingende Garde des Gewaltmonopols auf mich zu. Ich schluckte meinen Bissen und scheiterte im Versuch, meine Nichtbeteiligung mitzuteilen. Ich konnte den Atem der Behörden bereits fühlen, als endlich das Kommando durch die Kopfhörer zu hören war. Die Linie löste sich auf, doch das habe ich nicht mehr mitbekommen, so schnell entfernte ich mich aus der Situation.
Die Partys von Studierenden waren immer sehr pfleglich. Heftig, aber pfleglich. Hier gab es alles, was das Herz begehrte und es wurde auch mal laut, aber es gab keine toxischen Konflikte. Wobei… Es war selbstverständlich Alkohol im Spiel auf dieser Party im Prenzlauer Berg, in Sichtweite des touristisch bevölkerten Eberswalder Bahnhofs. Wie man an dem Touri Hotspot Prenzlauer Berg schon merkt, sind wir in der Postwendezeit der Nuller Jahre. Der Tatort: ein von Rauchenden überfüllter Balkon. Die Tatwaffe: eine leere Bierflasche. Der Tathergang: Unvorsichtigkeit und Gravitation. Ich denke, das Bild ist ausreichend verdeutlicht. Mein Gegenüber drehte sich um und kickte mit dem Hinterteil ein Bier von der Balustrade des Balkons. Ich sah der Flasche im Flug hinterher. Das hätte ich mal lieber sein gelassen. Die Flasche, die so angewinkelt war, dass ich ihr Etikett sehen konnte (unglaublich wie scharf man sehen kann, wenn man jung ist), entfernte sich von mir und zerschellte neben einer Person. Der junge Mann blickte erzürnt hoch und sah mich. Mit erhobener Faust drohte er. Allein die Lautstärke verhinderte, dass ich ihn auf meine fehlende Beteiligung hinweisen konnte. Aber auf der Party, so meine fehlerhafte Annahme, wäre ich für ihn nicht zu erreichen. Noch widme ich mich einem anderen eloquenten Gespräch über das Sein oder das Nichts in Call of Duty 2. Aus dem Augenwinkel sehe ich dann diesen aufgeregten jungen Mann, der dem erbosten Flaschenopfer recht ähnlich war. Es dauerte noch eine Sekunde, bis ich begriff. Der junge Mann schritt mit hassendem Gesicht auf unsere Position und ich war immer noch davon überzeugt, dass er doch verstehen müsste, dass ich gar nicht… Aber für eine Diskussion war er nicht die Stufen hochgestampft. Seine Worte gingen verloren, aber sein Schlag blieb mir in Erinnerung. Er traf mich auf die Nase, die bei voller Wucht sicherlich brechen müsste, was sie nicht tat. Der Zweifel obsiegte vor der Gewalt und verminderte die Stärke des Faustschlags, der ihm von Verstandeswegen als gerechtfertigt dargestellt wurde. Dennoch reichte die Wut für einen zweiten Schlag, der den ebenfalls unschuldigen Mann neben mir ins Gesicht traf. Anschließend stampfte er mit einem verwirrten Gesichtsausdruck davon. Der Schock über den Schlag saß tiefer als die physischen Schmerzen. Aber er hatte sicherlich eine Story für seine Saufkumpanen, dass er es uns so richtig gezeigt hatte. Das hatte er auf diese bizarre Weise, denn das Zögern gestaltet Aussagen mit einem ganz eigentümlichen Beigeschmack. Zögere vor dem Ja-Wort, zögere vor der Annahme der Arbeit, zögere vor dem Dienst an der Waffe. Selbstverständlich mit dem Werbeslogan: „Zögern! Jetzt in bunter Momentauswahl“
Ungeladen, aber mit berechtigtem Interesse kam auch ein Nachbar zu einer Party in Treptow. Natürlich brachten wir als schlechte Partygäste einen Wein mit und tranken den ganzen Abend nur Bier. Das Bier ging gewöhnlich als Erstes aus. Die Weinsorten, die sich da aufreihten, blieben den ganz Harten vorbehalten. Jene Nicht-Liierten, die gegen drei Uhr morgens noch nach Alkohol suchten und sagten: Okay, dann halt Kadarka. Dabei kann man daraus prima Mixgetränke machen, wenn man etwas findet, das den Geschmack übertüncht. Wir waren denn in der Ecke von Treptow, in der damals kein Späti-sei-Dank-Gebet mehr half. Es war eine andere Party mit derselben Bruchgeschichte einer Bierflasche. Ich glaube, da hatte einer die Hand nicht rechtzeitig aufbekommen, als er nach der Flasche griff und kickte sie damit mit einem kräftigen Schubs weg. Sie flog in einem steilen Winkel gegen das Fenster einer anderen Wohnung. Hinter diesem Fenster, so würde es ein wutentbrannter Vater gleich mehrfach betonen, schlief ein kleines Mädchen, das jetzt verängstigt wäre. Der Partygeber suchte sich in Vergebungsgesten und Wörtern, doch der Mann war aufgebracht. Er war nicht wirklich laut und er war nicht aggressiv, aber er war eindringend und aufdringlich. Das Fenster war nicht zerbrochen, hatte aber dennoch einen Schaden genommen. Doch beim Versprechen, das Fenster zu bezahlen, endete das Lamentum nicht. Unvermittelt war die Rede von Schmerzensgeld. Da es eine Auszugsparty war, ist mir der Ausgang dieses speziellen Konflikts entgangen.
Vielleicht täusche ich mich, aber früher gab es mehr Partys in Wohnungen in Friedrichshain. Oder? Es könnte natürlich auch mit dem altersbedingten Abends-Daheimsein zu tun haben. Sei es, wie es will. Diese Geschichte handelt von einem dieser Samstage, an denen man nicht so recht wusste, wohin, als uns die Ziellosigkeit durch den Südkiez vorbei an einer offenkundigen Party im ersten Stock trieb. Bunte Lichter spiegelten sich an der Decke, gute Musik dröhnte aus dem Inneren und ein Balkon voller Rauchwilliger erregte unsere Aufmerksamkeit. „Eine Party?“, wir sahen uns an. Eine WG-Party. Kurzerhand beschlossen wir selbst als ungeladene Gäste aufzuschlagen.
„Wollen wir uns einfach reinschleichen?“, fragte ich die Partygenossin. Sie zuckte verlegen mit den Schultern und verwies mit „Mal sehen!“ auf das Schicksal. Wir klingelten und die erste Hürde, die Haustür ward überwunden. Wir klopften und ein fragendes Gesicht blickte uns an. Diese Hürde würden wir wohl nicht so einfach überwinden. Meine Begleiterin brach das Eis: „Wir haben die Party gesehen und dachten, wir kommen einfach mal vorbei.“ Und die Antwort dieses Partygastgebers war: „Na dann kommt doch mal rein!“ Es war eine sehr angenehme Party mit tollen Gesprächen, von denen es kein Wort ins Langzeitgedächtnis geschafft hat.
Was ist eigentlich die Definition einer Party? Bei einem, sagen wir, sehr langen Abend in meiner WG kommt mir sofort eine Szene ins Gedächtnis. Ich war früher ein Freund der Auslegware. Das macht so ein heimeliges Gefühl. So war es auch damals in meiner WG. Wir saßen so herum und ich beobachtete einen Gast zweiter Ordnung – ein Anhängsel. Er hatte schon gut drei-acht im Turm und sein Sitzen vermittelte die ganze Beweglichkeit einer Seefahrt. Er rauchte selbstverständlich eine nach der anderen und als der Aschenbecher weg war, bemerkte ich eine kleine Handbewegung unter dem Tisch, der allerdings aus Glas war. Seine Hand war abgesenkt, während er eine emotional geladene Geschichte darbot. Dabei kreiste er eine Weile über dem Boden, um dann womöglich unbemerkt eine leichte Erschütterung auszulösen, wodurch sich der abgebrannte Teil der Zigarette ablösen sollte und eben auf jenen samtigen Boden fallen würde. Das hat mir die Notwendigkeit von Handsaugern verdeutlicht.
Genug von mir. Gibt es etwas, das die Partylegende übertrifft?