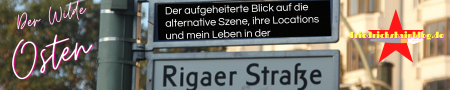Der Wilde Osten: Das Radfahren im Berlin der 90er Jahre
Du magst Individualverkehr? Dann fahr Fahrrad! Du willst Berlin näher kennenlernen? Dann fahr Fahrrad. Du kannst Dir den Luxus eines BVG-Tickets nicht leisten? Dann weißt Du, was zu tun ist. Übrigens ist ein ganz ordentlicher Vorteil: Solange Du trittst, kannst Du nicht runterfallen. Gleichgültig, welche Promillezahl sich in Dir staut. Also greif Dir Deinen Jolly Jumper und … Oh, warte! Ich muss Dich darauf hinweisen, dass der Vorschlag nicht ganz kostenlos ist. Was ist das schon in dieser Welt? Als Gegenleistung darfst / sollst / kannst / musst / wirst [Zutreffendes ankreuzen] Du Dir nun die alten Kamellen von anno dazumal reinziehen.
Das Fahrradfahren ist überall gleich. Es bestehen aber Nuancen im teuflischen Detail. Wie das Gefühl des Fahrtwinds im Gesicht und eine lauwarme Prise küsst Dich auf den Mund. In Berlin bedeutet das, dass man hinter einem anfahrenden Diesel-Lkw steht. Und das passiert nicht selten, aber gewöhnlich sind es die Abgase ganz normaler Fahrzeuge, die in abartigen Mengen Deine Lunge füllen. Es wurde mir zugetragen, dass man aber dennoch gesünder lebt, als würde man im Auto sitzen. Trotzdem? Ehrlich? Und die Fachperson im Fernsehen so: „Ja“. Plus die Bewegung. Plus die Kostenersparnis. Plus den diskutierbaren Spaß. Plus die Krankschreibungen. Ich glaube, ich halte den Rekord an Brüchen auf dem Rad in Berlin.

Egal von wo man startet, spätestens nach einer Stunde Radeln bist Du in Friedrichshain-Kreuzberg! Also innerhalb der persönlichen Tarifzone A. Auf dem Rücken des Bocks sah ich ein belustigendes, ein originelles und ein dreckiges Berlin, das zu Fuß außerhalb der Reichweite und mit einem motorisierten Reichweitenverstärker unzugänglich war! In Berlin habe ich mindestens eine Weltumrundung zurückgelegt. Wenigstens ein Drittel des Feinstaubs, der Logik und Weltkenntnis Dieter Nuhrs zufolge, stammt von meinen Fahrradreifen. Wenn man alle Reifen in meinem Leben aufeinanderstapelt, da kommt ein Haufen raus, der reicht mir bis ans Knie. Es wären weniger gewesen, wenn nicht so viele Scherben meinen Weg kreuzten … schnitten. So zwei, drei Platten gab es pro Jahr zu flicken. Wie oft schon sank ich darnieder und schrie mit bebender Stimme gen Himmel: „Halleluja, die Götter haben uns Antiplatt gebracht!“
Eines Tages fuhr ich, wie das manchmal halt so ist, nach Hause. Der Weg, die Danziger Straße runter schien frei, doch kurz bevor es den Prenzlauer „Berg“ runter ging, fuhr ich mir irgendwas ein. Es klackte bei jeder Umdrehung des Mantels auf der Straße. Es nervte. Es klackte, es klackte und je schneller ich fuhr, desto mehr Klacks pro Minute. Wie konnte ich die Fahrt genießen? Also abbremsen und checken. Es war zu meiner Überraschung kein Stein, sondern ein Stück Kunststoff. Bei näherer Betrachtung überkam mich die Ernüchterung: Es war ein Reißnagel mit bunter Kappe. Ich bin ja nicht blöde, ich überlegte kurz. Wenn ich den jetzt rausziehe, dann wird die Luft sehr wahrscheinlich entweichen. Aber ich bin auch hoffnungsvoll: Oder womöglich geht es einfach gut und ich fahre ohne ein Klacken weiter. Was habe ich getan? Was würden vermutlich alle tun? Es machte Pffff und ich war selbstverständlich Kapitän Plattfuß mit der Erkenntnis der wahren Bedeutung von Naivität.
Wie bereits in einem anderen Text (musst halt alle lesen, kann ich jetzt auch nichts machen) erwähnt, ist das Fahrrad die beste Möglichkeit, durch die Stadt zu kommen. Allerdings birgt es einen gewaltigen Nachteil, das ist die fehlende Knautschzone. Die braucht man in Berlin eigentlich schon. Vor allem wenn man die ruhigen Nebenstraßen in Ost-Berlin wie die Rigaer Straße mit dem rauen Pflaster im Westen verglich. Am Ku‘damm hatte ich deutlich mehr Angst als Radfahrer im Vergleich zur Stralauer Allee, was auch kein Zuckerschlecken war. Aber das Befahren der Frankfurter Allee oder der Warschauer Straße war Grund für Flüche und die Todesangst, vor allem wenn das Hosenbein vorm überholenden Auto schlottert. Was heute kaum noch vorstellbar ist, aber in der Rigaer Straße herrschte nie ein Mangel an Parkplätzen. Die vier, fünf Hände, die ein Fahrzeug steuerten, konnten immer direkt vor der Tür parken.
Dagegen sprach die Infrastruktur der Radwege in ganz Berlin eine wenig elaborierte, aber signifikante Sprache, nämlich: ‚Fuck off‘! Ein Beispiel ist heute noch zu sehen und war bis vor Kurzem bittere Realität. Ich spreche selbstverständlich vom Radweg auf der Frankfurter Allee Höhe U-Bahnhof Samariterstraße. Der Radstreifen verlief auf dem Fußweg und führte direkt am Ausgang der U-Bahn vorbei. An seinem Nadelöhrstellchen maß der Radweg sagenhafte 30 Zentimeter (geschätzt!). Lass es 35 Zentimeter sein. Von den gleichfalls geschätzten 15 Metern pro Fahrtrichtung der Frankfurter Allee stand die Verkehrsplanung dem Fahrrad einen Anteil von 30 Zentimetern zu. Um das Bild deutlicher zu malen: Das sind 0,2 Prozent. Gut, nur an einer Stelle. Aber mach das mal mit dem Auto… Und die Frankfurter Allee war, was Fahrradwege angeht, schon weit vorne. Die meisten Radwege in der Zeit waren gedachte Linien auf dem Asphalt. Dafür hatte die Oberbaumbrücke schon eingebaute Schienen, die dann doch nicht mehr genutzt wurden. Nach derselben Logik verbaute man auch Glasfaserkabel in der Karl-Marx-Allee. In den 90er Jahren war das die Zukunft. Doch in dieser Zukunft benötigte man Kupfer-Leitungen für das sogenannte DSL.
Es war auch noch vor dem Zeitalter der Arschkriminellsten – nein, nein, ich habe mich nicht vertippt. Die Arschkriminellsten, diese verkommenen Subjekte, die man in jenen Tagen des Fahrraddiebstahls bezichtigte. Obwohl der funktionierende Fuhrpark an Drahteseln in den 90er Jahren aus der Marke Diamant bestand. Diese DDR-Marke war zwar wenig luxuriös, meist sogar ohne Schaltung, aber unzerstörbar. Wobei ich auch diese Herausforderung meisterte. Der Rahmen eines gebrauchten Fahrrads, das hatte ich mir in der Libauer Straße für 50 DM geleistet, brach nach kurzer Zeit unterhalb des Sattels, sodass der Rahmen beim Treten etwas schwankte. Ich fuhr noch einige Kilometer damit, bevor mich ein Freund überzeugte, das Dingens zurückzugeben. Dort erstattete man mir entsetzterweise sofort das Geld. Ja, früher waren die Radläden noch von ihrer Ware überzeugt und zuckten bei Reklamationen nicht mit den Schultern, wenn sie den Kund*innen deren Dummheit diagnostizierten: „Bei dem billigen Zeugs, da kann man ja nichts erwarten…“
Tatsächlich war mein Verbrauch an Rädern gar nicht mal so klein. Ich kaufte mir ein Rennrad, das nur drei Monate hielt. Ich kaufte dann ein Tourenrad, das mir geklaut wurde und dann war es ein Tourenrad, dass ich fast fünf Jahre mein Eigen nennen konnte, bis es abermals geklaut wurde. Das Vorgängermodell lehrte mich aber eine wichtige Lektion über das Fahrradfahren in den 90er Jahren: Never trust an Alu-Lenker. Der Weg führte vom Volkspark Friedrichshain, wo man sich dem Vorglühen ergab, in den nahe gelegenen Knaack-Club. Es war ein lauer Sommerabend und versprach die ganze Herrlichkeit, die Berlin in den 90er Jahren im Sommer bot – die geilsten Partys, die die Menschheit jemals … Doch soweit sollte es an jenem Abend nicht kommen. Der Weg entlang des Parks geht zunächst nach oben und fällt dann zum Ende, Ecke Am Friedrichshain ab. Dort gab es an jenem schicksalhaften Tag auch schon eine Ampel und die zeigte rot. Also griff ich nach der Bremse. Doch zu meiner Verwunderung löste sich der Lenker in meiner Hand vom Rest der Lenkstange ab. Und während ich in eine Schieflage geriet, wobei ich mit guten vier Metern pro Sekunde dem Aufprall auf dem Asphalt entgegensah, wunderte mich der Griff in meiner Hand am meisten. Wie kann es sein, dass der Lenker … [Aufschlag]. Auf die Idee dennoch zu bremsen, kam ich in der Fülle an Gedanken nicht.
Als ich mir die Kiesel aus der Hand puhtle, fiel mir auf, dass mein Arm nicht mehr die volle Beweglichkeit hat. Mein Begleiter will mir zum Trost eins ausgeben, doch ich trete den Rückweg an. Mehr noch als die Bewegungsunfreiheit bemerkte ich die Unwucht im Vorderrad, das an einer Stelle so stark schliff, dass das Vorankommen mit jeden Meter einen beherzten Schub brauchte. Bis in die Rigaer Straße waren es wenige Kilometer, die wegen des Schocks gar nicht so schmerzhaft waren. Zumindest fehlt die Erinnerung daran. Wie mir am nächsten Tag mitgeteilt wurde, traf ich einen Freund in jener Nacht vor meinem Haus, der mir versicherte, ich hätte drei Mal die Sätze: “Ich hatte einen Unfall. Ich gehe jetzt heim” wiederholte. Am nächsten Tag, die Schwellung war unübersehbar, ging ich zum Röntgen in die Grünberger Straße. Es war in einem Kellergeschoss und damit recht kühl im Gegensatz zum warmen Sommer dieser Tage. Die Aussicht auf warme und regenfreie Tage erheiterten das Gemüt. Es war diese Vorfreude, die alles überstrahlte. Wenngleich die kaum belichtete Susterrain-Praxis sich Mühe gab, daran zu knabbern. Eine Vorahnung womöglich? Der Arzt war wohl auch vom sommerlichen Wohl berührt und pfiff so durch die inzwischen stille Praxis, in der alleine ein Telefon gelegentlich schellte und ich leichte Seufzer des Schmerzes von mir gab. Doch sein Pfeifen nahm ein abruptes Ende, als er mich im Wartezimmer sitzen sah. „Ach ja, Sie. Stimmt, da gab es ja noch etwas. Kommen Sie herein!“.
Er schob die Röntgenbilder in die Halterung und machte das Licht an. Er hob seine Brille und dokumentierte die Analyse mit ‚hmm‘s, mit ‚ahh‘s und endete mit einem „Okay.“ Er zeigte auf eine helle Stelle und doktorisierte über eine Fraktur im Knochen hier und da und überhaupt, „Sagen wir es mal so, Ihr Sommer ist vorbei“. Er sollte nicht unrecht haben. Der bandagierte Gips war mir der Spaßkeuschheitsgürtel für den Sommer. Dennoch gelang es mir, mit dem Fahrrad von A nach B zu fahren. Doch vorher erhielt ich einen neuen Lenker, der aus Edelstahl war. Denn, so die Weisheit über Alulenker aus den 90er Jahren: „Einen Mikroriss sieht man nicht, aber Riss ist Riss und irgendwann bricht er ab.“
Wenn meine Fahrräder hätten sprechen können, hätten Sie mir bestimmt von etwas anderem berichtet. Vermutlich von der Geschichte, als ich aus Lichtenberg nach Friedrichshain reingepest bin. Es war schon spät, vielleicht so gegen 1 Uhr, als ich die Unterführung an der Frankfurter Allee passiere. Dort standen eine Weile die dummen Nazis herum, als würde sich jemand davon einschüchtern lassen. Offenbar suchten die beiden Dummköpfe ein Opfer und da war ich auf dem Rad. Schon von einiger Entfernung konnte ich die beiden Gestalten unter der Laterne ausmachen, wenngleich mir der Sinn dieser Bewegungen nicht einleuchtete. Es würde nicht lange dauern, bis mich der Sinn in Form eines beherzten Tritts vom Fahrrad hauen sollte. Aber die physikalische Realität, die ihnen bei einem Schulbesuch vermutlich vermittelt worden wäre, war, dass ein Objekt mit einer Geschwindigkeit von rund 25 km/h bis 30 km/h mehr Energie bereithält, als es eine stehende Person mit einem Bein aushalten kann. Sein Fuß traf mich tatsächlich auf Brusthöhe, doch ich bemerkte nur einen kleinen Stupser, während der dumme Hund sich im Kreis auf seinem einen Bein drehte. Er traf nach der fast erfolgten Eigenumrundung seinen Kumpanen und die beiden Bomberjacken sanken zusammen hinab.
Und diese Geschwindigkeiten erreichte ich durchaus, vor allem auf den geraden Strecken. Dabei küsste ich auch schon mal eine Autotür von innen, als der Weg mich über den Prenzlauer Berg, also die Prenzlauer Allee, führte. Dort, wo der Radweg so rücksichtsvoll zwischen dem Gehweg und dem ruhenden Verkehr verlief. Dieser ruhende Verkehr bestand aus einem alten, etwas tiefergelegten Auto, dessen Tür genau vor mir aufging. Ich hätte bremsen können, nur meine alten V-Bremsen waren nicht für diese Geschwindigkeiten ausgelegt und der Bremsweg hielt über den Abstand zur Tür hinaus an. Ich hätte ausweichen können, aber der ältere Mann neben mir auf dem Rad sah weder mich noch die Gefahr der Kollision und unternahm folglich keine Anstalten, mir Platz zu machen. Es war dann noch ein Bruchteil einer Sekunde bis zur Begegnung mit dieser Autotür, die ich eigentlich gar nicht genau mitbekommen habe. Sehr wohl aber bemerkte ich die Konsequenz dessen: Ich flog über die Tür und landete nach einem nicht begonnenen Salto auf meinem Bauch. Ich konnte keinerlei Verletzungen feststellen. Aber ich grimmte die schockierte junge Frau auf dem Beifahrsitz an, die sich die Hand vor den Mund hielt. Ich checkte mein Rad, das erstaunlicherweise keinen Schaden davontrug und fuhr weiter. Der Grund für meine hohe Geschwindigkeit lag denn in der Zeitnot.
Meine Fahrradgeschichten sind geprägt von Knochenbrüchen, so auch als ich einen Fußgänger überfahren habe, als ich gerade am Café Moskau vorbeifuhr. Ich brauste mit gewohnt hoher Geschwindigkeit die Karl-Marx-Allee hinab und auf der Höhe des Cafés Moskau führte der Radweg auf dem Gehweg hoch. Dort war auch eine Veranstaltung, sodass ich sowieso schon abbremste, da ich eine Gefahr natürlich von rechts fürchtete. Plötzlich stand er unvermittelt auf dem Radweg. Da ihn sein Weg durch hohe Autos mit abgedunkelten Scheiben führte, ploppte er gut einen Meter von mir entfernt auf. Sein schockierter Blick verriet mir auch aus seiner Perspektive die unausweichliche Begegnung der aufprallenden Art. Was danach geschah, ist in meinem Datenspeicher nicht vermerkt. Offenbar aber übergab ich meine gesamte Bewegungsenergie an den jungen Mann, der vor mir auf dem Radweg lag. Er wurde bereits versorgt, es muss also etwas Zeit vergangen sein. Neben mir stand denn auch plötzlich ein Mann, der mir ein Taschentuch hinhielt. Mit besorgtem Blick erkundigte er sich nach meinem Befinden. Ein erster Check meiner Funktionen ergab keine Fehlermeldung. „Es geht mir gut“, sagte ich. Der Mann riet mir, mich mal im Spiegel im Café zu prüfen. Schon als ich mich langsam dahin bewege, erspähe ich rote Flecken auf meinem T-Shirt. Mein Spiegelbild erzählt den blutigen Unfallhergang, als wäre ich ein Zombie aus der Serie ‚Walking Dead‘. Ich wusch mich und erkannte erst allmählich das Ausmaß des Aufpralls, der meine Nase brach. Vor allem angesichts des Mannes, den ich umfuhr und der sich immer noch auf dem Boden befand. Der restlichen Geschichte Ende war eine Fahrt mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus, wo ich genäht und mein Unfallgegner geschient wurde. Wie ich erst viel später herausfand, war meine Schutzblechhalterung, bestehend aus den Blechstäben, abgerissen und drehte sich mit Schmackes um die Achse nach vorne, wo es die Beine des Unfallgegners aufriss und sich bis auf den Knochen vorbohrte. Sein Name ist mir entfallen, aber eines späten Abends klingelte er an meiner Tür. Wir hatten für Fragen der Versicherung die Kontaktdaten ausgetauscht. Es war schon um 23 Uhr. Und mit einigem Bedenken drückte ich den Buzzer zum Türöffnen. In diesem Augenblick drängte sich mir die Frage auf: War das jetzt eine so gute Idee, meinen Unfallgegner hereinzulassen? Was würde ich tun, wenn er gar nicht alleine ist? Das hätte ich mal vorher überlegen sollen! Ein Ton erklingt und der Fahrstuhl öffnet sich: Er war alleine. Als er dann in der Küche saß, fragte er aufgebracht: „Hast Du mich angezeigt?“. Ich wusste, es war ein Fehler aufzumachen. Ich suchte die Küche bereits nach Verteidigungswerkzeugen ab, als er von einer Anzeige wegen Körperverletzung erzählte. Ich versicherte ihm, dass ich keine Anzeige gestellt hatte und spekulierte, dass dies bei einem Unfall immer automatisch geschehe. Seine Aufregung legte sich ganz plötzlich. „Da hast Du vielleicht recht“, sagte er und verschwand in derselben Minute. Noch im Gehen biete ich ihm, ganz der Gastgeber, noch ein Bier an. ‚Bin ich denn noch zu retten? Bitte Nachdenken, bevor ich noch irgendetwas tue oder sage!‘ Er lehnte glücklicherweise ab.
Fahrradfahren in Berlin ist heute ein äußerst hartes Pflaster. Aber damals, machen wir uns nichts vor, war auch nicht alles Koks, was weiß war, und das Fahrradfahren war ein schmerzhaftes Los. In den Anfängen der Fahrradkuriere erzählte man sich in der Straßmannstraße die Geschichte des edlen Boten von hoher Gestalt und mutigem Herzen. Eine Freundin, die sich in der Bar ‚Drittes Ohr‘ verdingte, trug mir die Geschichte zu. Der großgewachsene und kräftige Mann, der der deutschen Sprache nicht mächtig war, traf auf einen Nazi, der unseren schwarzhäutigen Helden beim Fahrradfahren rassistisch beleidigte. Der Bösewicht war ausgemacht und das Gute musste obsiegen. Er lenkte sein treues Gefährt zurück und trat wiederholt in die Pedale, bis die Muskeln schmerzten. Und mit geöffnetem Schloss, welches er zu Ehren der Göttin Securtias um den Hals trug, trafen die beiden wieder aufeinander.
Überhaupt sind Fahrradkuriere sehr solidarische Fahrradfahrende. So will ich mit dieser Geschichte fortfahren, die sich auf der Leipziger Straße an einer Ampel zugetragen hat. Ich wartete auf das grüne Licht, als ein Auto so dicht an mir vorbeifuhr, dass nur noch ein Finger zwischen seinem Reifen und meinen Schuh passte. Ich brachte meinen Unmut darüber zum Ausdruck, was der Autofahrer mit einem grinsenden Stinkefinger quittierte. Selbstverständlich quoll meine Wut weiter an und ja, ich brüllte auf das geschlossene Fenster zu. Der Mann ließ seinen Motor aufheulen und rangierte neben mir herum. Es war ein performatives Drohen mit den Autoreifen. Aus dem Augenwinkel erblicke ich eine sich nähernde Person. Es war ein Fahrradkurier. Er stellte sich auf die andere Seite des Wagens, wo der Fahrer saß. Mit kräftiger, aber ruhiger Stimme forderte er den Autofahrer auf, die Tür zu öffnen. Er wolle mal mit ihm reden. „Jetzt bist Du nicht mehr so mutig, oder?!“, brüllte der doch stattliche Mann auf den Fahrer ein, als dieser sich weigerte, sein Auto zu verlassen. Dann wurde es grün und der Wagen fuhr schnell an. An dieser Stelle noch mal ein Dankeschön, welches im Lärm der fast quietschenden Reifen des Randalierers unterging.
Abschließend möchte ich noch zum Ausdruck bringen, was für eine asoziale Idee es ist, Schwarzfahren als Straftat zu behandeln.